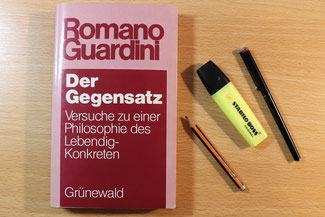
Dem synodalen Weg – von (weit) außen zugeschaut.
Es sind wahrlich unterschiedlichste Eindrücke, Berichte, Statements und Kommentare, die in diesen Stunden nach der ersten Synodalversammlung auf den wohlmeinenden Gläubigen einprasseln. Wie kann und soll man sich da sortieren, geschweige denn positionieren? Braucht es überhaupt schon Positionierung und medial krachende Wortfassaden? Ist die Versammlung nicht erst dabei, Denklinien freizulegen und sich in unendlich viele Komplexitäten vorzutasten?
Um hier das Feld zu begehen, haben mir Gedanken des Religionsphilosophen Romano Guardini gutgetan, vor allem seine vor knapp einhundert Jahren veröffentlichte Gegensatzlehre.
Die Synode offenbart - und das ist gar nicht schlimm - zahlreiche Spannungen und Momente des Gegensatzes. Nach Guardini helfen solche Gegensätze dem „Aufgetansein der Augen“ und bei der Suche nach der inneren Richtung im lebendigen Sein. Wenn es um „Neudenken aus der Sache“ gehen soll, kann das Bau- und Wirkprinzip des Gegensatzes Richtung und Maß sein. „Feste Haltungen“ dürfen sein, weit besser denn „schillerndes Ineinander“. Das „Erlernen der Schwebe“ und nicht die voreilige Befriedung sind hilfreich, wenn es um gegenseitige Annäherung geht.
Mit seinen Hinweisen zum Gegensatz fordert Guardini dazu auf, Beschränktheiten durch das Sehenlernen größerer Zusammenhänge aufzuheben. Gefordert ist dafür vor allem Offenheit. Selbst scharfe Grenzziehungen sind erlaubt, ja notwendig. Doch es müssen schlussendlich „bejahte Grenzen“ sein, nicht mit Widerwillen eingeräumte.
Guardini hält mit dem Denken des lebendig-konkreten Gegensatzes eine souveräne Neufassung beladener und belasteter Begriffe und auch kirchlicher Positionen für möglich. Es geht in der Tat um nicht mehr und nicht weniger. Schafft es die Kirche, Handlungsspielräume und theologische Vorstellungen so zu erweitern, dass Gott neu sichtbar wird, ja neu sein darf?
zurück zur BLOG-Übersicht
